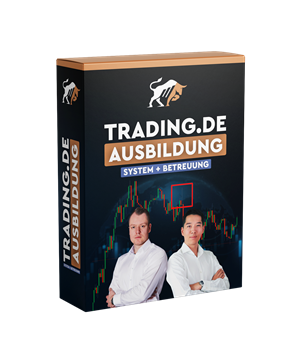Finde die wichtigsten Begriffe zum Trading lernen in unserem Lexikon:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z